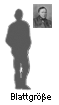Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 16. Woche - 18. bis 24. April 2011
Am 25. April 1861 – vor 150 Jahren - zog ein Leichenzug durch die Stadt nach Melaten, der in seiner Pracht kaum jemals hier stattgefunden hatte. Drei Tage vorher war der Rentier Richartz gestorben, und nun wurde sein Sarg unter einem Baldachin mit lorbeerumschlungener Bürgerkrone zum Friedhof überführt. Der Architekt Josef Felten schritt hinter dem Sarg einher und präsentierte die Orden und Ehrenzeichen des Verblichenen. Natürlich hatte sich der Oberbürgermeister eingefunden, mit ihm die Beigeordneten und der komplette Stadtrat, die Behördenspitzen der städtischen Ämter und die hohe Geistlichkeit. Dem halbstündigen Zug folgten hundert Pferde-Kutschen. Unzählige Bürger säumten die Straßen und erwiesen Richartz die letzte Ehre. Wer war dieser Mann, dem im Tod eine derart überwältigende Dankbarkeit erwiesen wurde? Wenn nicht der Name des Wallraf-Richartz-Museums noch heute in der Stadt und darüber hinaus allgegenwärtig wäre, Richartz wäre jetzt vergessen. Doch ist sein Name dank der sich in dieser Benennung ausdrückenden Verbindung mit seiner größten Mäzenatentat stets lebendig geblieben. Denn 1854 spendete er der Stadt 100.000 Taler zum Bau eines Museums für die Sammlungen des 1824 gestorbenen Kanonikus Ferdinand Franz Wallraf. Seit dessen Tod wurden sie in der Stadt hin und her geschoben und hätten schon um ihrer schieren Erhaltung willen längst einer dauernden Heimstatt bedurft. Auch die damals bereits durchaus mögliche und hier tatsächlich eintretende Verdopplung der Baukosten fing Richartz geduldig auf. Doch damit nicht genug: 37.000 Taler spendete er für die Restaurierung der an das Museumsgebäude anstoßenden Minoritenkirche und auch der Druck von Wallrafs gesammelten Schriften, die pünktlich zur Eröffnung des Museumsbaues erschienen, ging auf seine Rechnung. Dabei fühlte er sich gar nicht in erster Linie der Kunst verpflichtet, sondern ganz allgemein dem Wohlergehen seiner Heimatstadt. Und so ist ihm auch eine Spende von 100.000 Taler für den Bau einer polytechnischen Schule zu danken, oder die testamentarische Überlassung weiterer 100.000 Taler zum Bau eines Irrenhauses. Diese enormen Spenden gab er ohne Hintergedanken. Nun gut, er freute sich über die zahlreichen öffentlichen Ehrungen, die Ernennung zum Kommerzienrat etwa, oder die Verleihung des Roten Adlerordens dritter Klasse, wünschte zum Ärger des für die Dekoration des Museumstreppenhauses ausgewählten Malers Edward von Steinle etwas zu aufdringlich die Verewigung seiner Mäzenatentat im Freskenprogramm. Auch bestimmte er seinen Freund Josef Felten zum Museumsarchitekten. Sonst aber ließ er der Stadt freie Hand und insbesondere hatte er keine wirtschaftlichen Interessen. Denn die Zeit seiner überaus erfolgreichen Geschäftstätigkeit war damals schon vorbei.. Richartz entstammte einer alten Kölner Gerber-Familie. Schon sein Vater verdiente sein Geld aber weniger mit dem Gerben, sondern mit dem Handel von Wildhäuten, zunächst einheimischer, später dann aus Südamerika importierter Ware. Johann Heinrich übernahm das schon damals florierende Geschäft 1816 und führte es mit größtem Erfolg weiter. Der Häutehandel gehörte in Köln vor der Mitte des Jahrhunderts zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen und die Kölner Händler dominierten den gesamten deutschen Markt. In Köln gehörte die Häutegroßhandlung von Richartz neben den Handelsfirmen von Jansen, Hölterhoff und Rautenstrauch zu den umsatzstärksten. Um 1851 zog sich Richartz aber aus dem Geschäft zurück. Der schwerreiche Junggeselle lebte persönlich ganz anspruchslos, verbrachte die Sommerzeit meistens auf Reisen, kehrte aber im Herbst stets in seine Heimatstadt zurück, ein kölsches Urgestein, dem derber kölscher Humor zugeschrieben wurde. In der Gesellschaft „Im Hahnen“, die städtischen Traditionen lebte und sie bewahrte, war er tragendes Mitglied. Ein spezielles Interesse für Kunst wird ihm nicht nachgesagt. Wohl hatte er eine gewisse Theaterleidenschaft, doch liebte er besonders Travestien und Parodien berühmter Opern und Theaterstücke. Die Aufführungen der „Cäcilia Wolkenburg“ des Kölner Männer-Gesang-Vereins hätten ihm sicherlich sehr gefallen. Auf Melaten ruht er nun in einem Ehrengrab an der Seite Wallrafs. Sein Museumsbau ist den Bomben des Zweiten Weltkriegs zwar zum Opfer gefallen, doch ist es sehr wesentlich diesem Gebäude und damit seinem Stifter zu verdanken, dass Wallrafs Kunstsammlung überhaupt in sich geschlossen und in gutem Zustand erhalten blieb.
G. Czymmek