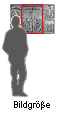Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 13. Woche - 25. März bis 1. April 2002
Mit dem vergangenen Sonntag, dem Palmsonntag, hat im westlich-christlichen Kulturkreis die Karwoche 2002 begonnen, die Woche, in welcher das Leiden und Sterben Jesu Christi im Mittelpunkt der Liturgie und des religiösen Lebens steht. Dies soll zum Anlaß genommen werden, im Bild der Woche die Mitteltafel eines kleinen, um 1330 gemalten Altärchens (s. kleines Bild) im Wallraf-Richartz-Museum näher zu betrachten, bei deren Darstellung es um die Kreuzigung Christi geht und welche zugleich ein Beispiel für die franziskanische Spiritualität in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist. Unser Bild zeigt Christus am Kreuz. Er ist tot, das Leiden ist vollbracht. Unter dem Kreuz stehen nebeneinander und hintereinandergereiht einige der am Geschehen beteiligten Personen: Links die Mutter Jesu, umgeben von den "Drei Marien", ihren beiden Schwestern und Maria Magdalena; rechts Johannes der Evangelist, daneben der Hauptmann, der ein Spruchband in seiner Hand hält, auf dem ursprünglich das Bekenntnis zu lesen war, welches er beim Tode Jesu ablegte: Dieser war wirklich Gottes Sohn. Ganz rechts vermutlich zwei Pharisäer, die zur Gruppe der Mörder Jesu gehören. So weit die "klassische" von den Evangelisten beschriebene Kreuzigungsszene. Darüber hinaus fallen drei Darstellungsbereiche auf, welche der Szene ihren besonderen Charakter verleihen: 1) Das Blut Christi spritzt in heftigen Stößen aus den Wunden. Unter den Nagelwunden in den Händen fangen Engel das Blut in Kelchen auf - ein Hinweis auf die Meßfeier, in welcher der Wein im Kelch in das Blut Christi verwandelt wird. 2) Das Blut der Seitenwunde verteilt sich breit. In der Wunde steckt noch die Lanze, die gerade von einer - der Legende nach Longinus genannten - Person in den Körper des Toten gestoßen wurde. Erstaunlicherweise kniet Longinus. Mit seiner Rechten weist er auf sein geöffnetes linkes Auge, während das rechte Auge geschlossen ist. Für den mittelalterlichen Menschen war diese Darstellung sofort schlüssig: Der Soldat Longinus, der als Blinder an der Kreuzigung Christi teilnahm und Christus die Lanze in die Seite stieß, konnte in dem Moment wieder sehen, als das Blut der Seite auf sein Auge spritzte. Auch hier steht also das Blut Christi im Mittelpunkt. 3) Auch die Fußwunde sprudelt. Hier sieht man jedoch keine Engel oder Heiligen. Das Blut läuft den Stamm des Kreuzes hinunter. Am Fuß des Kreuzes kniet eine Nonne, die Abtissin eines Clarissenklosters, vermutlich des Kölner Klosters St. Klara. Die Hände der Ordensfrau sind nicht gefaltet, vielmehr sind sie flehend emporgehoben - vielleicht strecken sie sich auch den Blutstropfen entgegen. Die Darstellungen der Kreuzigung ist in diesem kleinen Altärchen also eng mit dem Thema Blut Christi verbunden und legt damit den theologischen Schwerpunkt der Aussage auf den Sühnecharakter des Todes Christi: "Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösepreis für viele" (Mk 10,45). Dies paßt sowohl in den historischen Kontext, in eine Zeit, die von einer starken Betonung der mystischen Leidensbetrachtung geprägt war, als auch in die spezielle Spiritualität, wie sie in den franziskanischen Klöstern gepflegt wurde. Von der Ordensgründerin St. Klara angefangen gehörte die Verehrung des Kreuzes Christi zu den Schwerpunkten der Frömmigkeit der Klarissinnen. Von der heiligen Klara, die etwa 100 Jahre vor unserer Stifterin lebte, wird in ihrer Vita berichtet, daß sie ständig zu den Wundmalen Christi betete. Unsere Stifterin, die vielleicht Petronella von Schwerwe hieß, folgt diesem Vorbild bildhaft noch heute, seit 670 Jahren.
T. Nagel