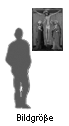Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 03. Woche - 20. Januar bis 26. Januar 2014
Eine ganze Reihe von Charakteristika machen diese, auf den ersten Blick thematisch nicht sonderlich auffallende Tafel, zu einem in doppeltem Sinne betrachtenswerten Kleinod. Das dargestellte Thema, Christus am Kreuz zwischen Maria (links) und Johannes (rechts), entspricht dem oft dargestellten sogenannten Kanonbild. In dieses heilsgeschichtliche Bildmotiv webt der Autor des Werkes auch eine erzählerische Episode des Kreuzigungsgeschehens ein, so wie dieses von einem der Evangelisten – nämlich dem dargestellten Johannes – berichtet wird (Joh 19,25-27): Auf den beiden großen, oberen Spruchbändern kann man die Worte lesen, mit denen Jesus vom Kreuz herab seine Mutter der Obhut des Johannes anvertraute und diesen wiederum – theologisch gesehen stellvertretend für die ganze Menschheit – seiner Mutter: Wif sich din kint und Joh'es sich din muder (Weib, siehe dein Kind – Johannes, siehe deine Mutter).
Seltenheitswert hat diese nach dendrochronologischen Untersuchungen um 1425/30 entstandene Tafel vor allem durch die in den Bildträger eingesetzten, plastischen Köpfe. Deren spezielle Ausformung läßt den Schluß zu, daß sie für dieses Werk angefertigt wurden und nicht sozusagen "Reste" einer figürlichen Kreuzigungsgruppe sind. Darüberhinaus gibt es Anhaltspunkte dafür, daß der Bildschnitzer auch der Urheber der Malerei war (etwa die hohe Qualität der Köpfe und die untypische, schwarze, vorzeichnungsartig auf den roten Grund gemalte Kontur der Darstellung). Warum die Köpfe der Personen nicht gemalt, sondern plastisch angesetzt wurden, läßt sich nicht genau klären. Deutlich ist jedoch das Ergebnis dieser Kombination von Malerei und Plastik: Die Steigerung der emotionalen Wirkung. Diese mag sogar wegen des– etwa in einer dunklen Kirche – unerwarteten, dreidimensionalen Effektes noch über die Wirkung einer vollplastischen Figurengruppe hinausgegangen sein.
Eine weitere Funktion der Tafel wird durch die beiden am unteren Bildrand im Bedeutungsmaßstab dargestellten Personen deutlich: Dem Stifterehepaar sind Schriftbänder beigegeben, die aus den Psalmen 26 und 50 zitieren und die Barmherzigkeit Gottes erflehen. Diese für die Stifter auch über ihren Tod hinaus Gott anrufenden Bitten korrespondieren mit der malerischen Betonung des Blutes Christi im Bild, welches "vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden" (Mth 26,28): Man sieht dicke, fallende Tropfen, zähfließende, vom Rand des Lendentuches gestaute Blutströme. Die rote Farbe selbst wird – im Gegensatz zur übrigen Malerei – geradezu plastisch aufgetragen.
Ein interessantes Detail sind in diesem Zusammenhang, die bei plastischen Köpfen besonders gut darzustellenden roten Blutstropfen auf dem Schleier Mariens. Motiviert sind diese durch ein populäres Buch des Pseudo-Anselmus (Interrogatio de passione Domini), in welchem die Tropfen als Beleg für das Ausharren Mariens unter dem Kreuz bis zum letzten Atemzug Jesu angeführt werden.
T. Nagel