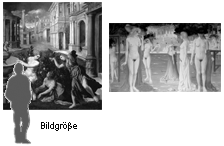Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 28. Woche - 10. bis 16. Juli 2006
Anläßlich des Jubliäums 2006 – 30 Jahre Museum Ludwig, 20 Jahre Neubau am Rhein, 5 Jahre Neubau am Rathausplatz – entleihen die beiden Museen (Wallraf-Richartz-Museum – Fondation Corboud und Museum Ludwig) für eine Dauer von jeweils drei Monaten vier Mal Hauptwerke ihrer Sammlugen, um diese gegenüberzustellen (s. BdW 03/2006, BdW 11/2006, BdW 15/2006, BdW 17/2006). Es werden neue unerwartete Blicke möglich. Bis zum 24.09.06 treffen so Werke von Paris Bordone (Treviso 1500 - 1571 Venedig, s. a. BdW 28/1998) und Paul Delvaux (Antheit-les-Huy 1897 - 1994 Veurne) im Wallraf-Richartz-Museum aufeinander. Träumereien Jenseits aller kunsthistorischen Bezüge und Widersprüchlichkeiten sollte die Zusammenschau dieser beiden Bilder unter surrealen Maßstäben erfolgen, denn diese Sicht ist sicherlich der Kontrapunkt der beiden Bilder. Batseba, um mit dem älteren Gemälde zu beginnen, sitzt auf dem Brunnenrand in einem Zitronenhain und läßt es sich wohl ergehen, umsorgt von zwei Dienerinnen. Dies die Erscheinung, unwirklich vor dem Betrachter ausgebreitet und natürlich erst recht unwirklich in ihrer Schönheit. Denn wie in einer Traumvision materialisiert sich die Gruppe in einer von Renaissance-Palästen gesäumten Straße - ohne Übergang auf einer natürlichen Insel mit Rasenteppich, der unvermittelt in die Geometrie der plattierten Straße übergeht. Die drei schönen Frauen sind in ihren Bewegungen aufeinander bezogen, in ausdrucksstarken und eleganten Gesten dargestellt und nehmen ihr Umfeld nicht wahr, achten also weder auf König David, der im Fenster seines Palastes liegt und die schöne und begehrenswerte Bathseba belauert, noch auch auf deren armen Gemahl Urias, der im Auftrag Davids und als Todesbote seiner selbst zum Stadttor hinausreitet, um nicht mehr wiederzukehren. Die Zeit hat ein surrealistisches Übriges getan und die Figur König Davids gleichsam durchsichtig werden lassen als hingehuschte Erscheinung vor dem Hintergrund des architektonischen Lineaments. Ähnlich in ihrer Traumverlorenheit sind die Waldnymphen von Delvaux gegeben. In ihrer Anordnung fast selber als Wald gesehen und in ihrer Statuarik und in der solitären Selbstbezogenheit als Baum, aufrecht, mal frontal, mal im Profil, mal rückseits und mal von der Seite, sind sie drapiert mit bunten Tüchern, die nicht verhüllen, sondern ihre Blöße gleichsam nur hinterfangen. Die Dryaden sind dem vordergründig sich ausbreitenden Meer nicht entstiegen, sondern eher entwachsen gleich einem Baum mit einer Laubkrone in Form aufwändiger Hutcreationen. Jenseits der streng bildparallel gegebenen und zum Wasser hin gestuften Uferpromenade öffnet sich ein Platz mit Ausblick nicht auf ein erwartetes Häusermeer, sondern auf ein Konglomerat renaissancehafter Fassadenmotive. Auch hier werden Dryaden sichtbar, nun durchaus auch bekleidet und wiederum zumeist als statuarische Erscheinungen pflanzenhaft gesehen. Zwei Elemente also verbinden beide Bilder: - Das Renaissancezitat- , einmal als gelebte Gegenwart, wenngleich kulissenhaft und in architekturtheoretischer Perfektion eingesetzt, dann als ferner und traumhafter, dem mythologischen Thema angemessener Hinweis auf die Antike. - Das Element weiblicher Schönheit -, einmal präsentiert und in seiner Präsentation begründet in alttestamentarischem Zusammenhang - wenngleich nicht unbedingt zu religiöser, sondern eher zu recht weltlicher Erbauung, dann als ganz eigenständiger Beitrag zur Interpretation antiker Mythologie und ebenfalls nicht gedacht für die Mythothek des Archäologen, sondern entstanden durchaus im Bemühen um ein recht weltliches Interesse an einem traumhaften Geschehen. Schließlich: Bordone hat - dieser surrealistische Hinweis sei erlaubt - Delvaux nicht gekannt, doch ist anzunehmen, dass Delvaux sich im Laufe seines langen Lebens einmal über die belgische Grenze und nach Köln in das Wallraf-Richartz-Museum begeben hat. Er wird dieses Bild also sicherlich studiert haben und so mag seine Komposition als traumhafte Reminiszenz an eine Begegnung mit ihm entstanden sein. Denn auch die Eigenheit der in ähnlicher Proportion und in kompositionell angenäherter Weise sich zusammenfindenden heterogenen, untereinander aber vergleichbaren Bildteile erlaubt die weitergehende Vermutung einer Begegnung von Maler und Bild - in Köln oder doch in einem Traum?
G. Czymmek