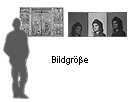Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 15. Woche - 10. bis 16. April 2006
Anläßlich des Jubliäums 2006 – 30 Jahre Museum Ludwig, 20 Jahre Neubau am Rhein, 5 Jahre Neubau am Rathausplatz – entleihen die beiden Museen (Wallraf-Richartz-Museum – Fondation Corboud und Museum Ludwig) für eine Dauer von jeweils drei Monaten vier Mal Hauptwerke ihrer Sammlugen, um diese gegenüberzustellen (s. BdW 03/2006, BdW 11/2006). Es werden neue unerwartete Blicke möglich. Bis zum 25. 06. 2006 treffen so ein mittelalterliches Triptychon und Andy Warhols Jackie Triptych (im Wallraf-Richartz-Museum) aufeinander. Passions-Triptychon Warhols „Jackie Triptych“ und das kölnische Triptychon von ca. 1350 verbindet zunächst ein Mißverständnis: Beide sind irreführenderweise mit dem Begriff „Altarbild“ in Zusammenhang gebracht worden. Nun handelt es sich bei dem mittelalterlichen Gemälde zwar um ein Triptychon, dessen beidseitig bemalte Flügel zugeklappt werden können. Auch verweisen die Bilder aus dem Leben Jesu auf die wichtigsten Feste des Kirchenjahres. Dennoch diente es wohl einem anderen Zweck als die großen „öffentlichen“ Altarretabel, die feiertags geöffnet und alltags geschlossen waren. Die Kölner Klarissen, aus deren Kloster es stammt, waren auffallend kunstliebend: Eine für sie geschaffene Gruppe von kleinformatigen Werken (darunter dieses Werk mit der Inventarnummer WRM 1) gehört zu den ältesten erhaltenen deutschen Tafelbildern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei unserem Triptychon um ein Andachtsbild, das der persönlichen Versenkung der Nonne diente (s. hierzu a. BdW 13/2002). Die Dreiteilung von Warhols Gemälde erinnert an mittelalterliche Objekte wie WRM 1. Im Gegensatz zu anderen Triptychen des 20. Jahrhunderts lassen seine Proportionen aber kein Verschließen der Mitteltafel durch die Flügel zu. Das Werk besteht aus drei gleich großen Leinwänden, die jeweils (als Siebdruck) Jacqueline Kennedy zeigen. Es stammt aus einem umfangreichen Werk-Zyklus, der das erste globale Medienereignis spiegelt: Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy in Dallas Opfer eines Attentats. Millionen Menschen weltweit verfolgten die Geschehnisse in Radio, Zeitung und Fernsehen. Vor allem die westliche Welt, die in dem jungen, gutaussehenden amerikanischen Präsidenten spätestens seit der souverän gemeisterten Kuba-Krise eine Lichtgestalt sah, war zutiefst schockiert. Andy Warhol hörte die Nachricht vom Attentat in seinem Atelier und reagierte nach eigenem Bekunden kühl: „Ich war begeistert gewesen, Kennedy zum Präsidenten zu haben (…), aber es machte mir nicht so sehr viel aus, daß er tot war. Woran ich Anstoß nahm, war die Art und Weise, wie Fernsehen und Rundfunk jedermann auf Trauer programmierten.“ Anders als sein Kollege Rauschenberg, der im monumentalen Historienbild „Axle“ von 1964 (Museum Ludwig Köln) an den tatkräftigen und redegewandten John F. Kennedy erinnert, konzentrierte sich Warhol auf Jackie Kennedy, jene glamouröse und fotogene Gattin des 35. Präsidenten, die in den USA als ideale First Lady, gar als „Königin Amerikas“ galt. Das hier (teils spiegelbildlich) verwendete Pressefoto zeigt sie beim Begräbnis in Arlington am 25. November 1963. Nach dem Attentat war sie erst am 24. November, bei der Überführung des Leichnams vom Weißen Haus zum Kapitol, wieder öffentlich aufgetreten. Ganz Amerika, ja die Welt blickte auf ihr Gesicht, das zu einer Projektionsfläche für die kollektive Trauer wurde. Bei den Trauerfeierlichkeiten wurde Jackie von ihren Kindern Caroline und John begleitet. Die Dreiergruppe aus schwarz verschleierter Präsidentenwitwe und zwei flankierenden, in blaue Mäntelchen gehüllten Kindern war in den Medien omnipräsent und hat in der Farbkomposition des „Jackie-Triptych“ ihr Denkmal gefunden (s. hier). Darüber hinaus verweisen die Blautöne des Bildes auf traditionelle Farbsymbolik: In der mittelalterlichen Malerei – siehe WRM 1 – ist die Farbe des Himmels zugleich (und neben Rot) Farbe Mariens. Tatsächlich suggeriert das „Jackie-Triptych“ quasi filmisch eine Himmelfahrt „Mariens“, wozu auch die Untersicht des verwendeten Fotos beiträgt. Selbst als starres Bild gemahnen die drei Jackies an religiöse Malerei, wie der vergleichende Blick auf die drei trauernden Marien in der „Wehrdener Kreuzigung“ (WRM 883 – siehe Bild rechts) zeigt. In diesem Kontext erklärt sich nun auch die Farbe des mittleren Bildfeldes: Das helle Silbergrau ist, als Verweis auf den „silver screen“ (Film-Leinwand), mithin auf die Aureole der Stars und Superstars von Film und Medien, ein modernes Äquivalent zum himmlischen Goldgrund mittelalterlicher Malerei. Der löchrige, körnige, im mittleren Bildfeld besonders feine schwarze Farbauftrag läßt das lebensgroße Bild der Präsidentenwitwe wie einen geisterhaften Abdruck auf dem textilen Bildträger erscheinen – ein Schweißtuch der Heiligen Jackie. Kennedys Fahrt durch Dallas als Kreuzweg; Jackie als Ikone: Es scheint als antworte Warhol auf die (abstrakten) „Stations of the Cross“ seines Malerkollegen Barnett Newman. Das Aufgreifen der „Pathosformel“ Triptychon unterscheidet die Jackie-Serie von anderen Zyklen Warhols. Das Kölner „Jackie Triptych“ widerspricht in seiner Tiefgründigkeit Warhols angeblicher Reaktion auf das Attentat. Offenbar handelte es sich um ein Geschenk für seinen Förderer Henry Geldzahler, damals Assistant Curator am Metropolitan Museum. Am 22. November 1963 hatte der erschütterte Freund mit Warhol telefoniert, und es scheint, daß das Triptychon für ihn geschaffen wurde. Allerdings konnte sich der „coole“ Künstler dahinter zurückziehen, daß sein Werk lediglich die eigene Herstellung vorführe. Wie Ulrich Heinen jüngst erkannte, bildet das „Jackie Triptych“ das Siebdrucken selber ab, das mit dem Auf- und Zuklappen eines Triptychons durchaus vergleichbar ist: Links das beiseite geklappte Sieb mit scharfen Umrissen, rechts der übersättigte Probedruck, in der Mitte das sauber und subtil gedruckte Ergebnis.
R. Krischel