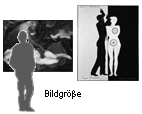Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 17. Woche - 24. bis 30. April 2006
Anläßlich des Jubliäums 2006 – 30 Jahre Museum Ludwig, 20 Jahre Neubau am Rhein, 5 Jahre Neubau am Rathausplatz – entleihen die beiden Museen (Wallraf-Richartz-Museum – Fondation Corboud und Museum Ludwig) für eine Dauer von jeweils drei Monaten vier Mal Hauptwerke ihrer Sammlugen, um diese gegenüberzustellen (s. BdW 03/2006, BdW 11/2006, BdW 15/2006). Es werden neue unerwartete Blicke möglich. Bis zum 25. 06. 2006 treffen so ein Werk Anton van Dycks und Francis Picabias "Spanische Nacht" (im Museum Ludwig) aufeinander. Begehrliche Blicke Hier nähert sich Jupiter als Satyr in lustvoller Erwartung der schlafenden Antiope, dort umwirbt ein silhouettenhaft schwarzer Flamencotänzer die als weiße Aussparung anmutende Gestalt eines weiblichen Akts. Drei Jahrhunderte liegen zwischen beiden Bildern, geradezu entgegengesetzt ihr malerischer Duktus, die Modellierung der Körper, und doch zeigen sie verblüffende formale wie inhaltliche Parallelen in der dialektischen Komposition eines Geschlechterschemas - zwei ausgesprochene Machos und das jeweilige Objekt ihrer Begierde. Während seiner Tätigkeit in der Werkstatt von Rubens schuf der zwanzigjährige van Dyck sein mythologisches Figurenpaar. Die untere Bildhälfte dominiert der auf Tüchern lagernde makellos weiße Frauenkörper, der sich vor der Schwere des umgebenden Kolorits abhebt und die Wertschätzung des Künstlers für Tizian verrät. Über Antiope beugt sich der in kräftig braunem Inkarnat gegebene Jupiter als Fruchtbarkeitsdämon, den Arm ausgestreckt, um das rote Tuch zu heben, das die Scham der Schlafenden bedeckt. Ihm zugesellt ist als Erkennungszeichen der Adler, der mit gleich gerichtetem Kopf und scharfem Schnabel den begehrenden Blick des Satyrn unterstreicht. Noch ahnt die Tochter des Königs von Theben nichts vom Ansinnen des Göttervaters, geschweige dem schweren Schicksal in Folge ihrer Liebschaft. Die Geburt der Zwillinge Amphion und Zethos, die auszusetzen sie gezwungen sein wird, der Tod ihres Ehemannes König Epopeus von Hand ihres Onkels Lykos und die jahrelange Knechtschaft unter dessen tyrannischer Frau Dirke – all dies steht lediglich als kognitive Betrachterebene hinter der Darstellung, die sich ganz auf den Moment männlicher Annäherung im kontrastierenden Formspiel der Körper konzentriert. Dieses Grundthema dominiert ebenso Picabias scherenschnitthafte „Spanische Nacht“, nach seinen Maschinenbildern der Dada-Zeit 1922 als erste einer Reihe figürlicher Kompositionen an einem Wendepunkt seines facettenreichen Schaffens entstanden. Mann und Frau sind auch hier zwei getrennten, nun vertikalen Bildhälften zugeordnet, vor deren Fond sie sich wechselweise in hartem Schwarz-Weiß-Kontrast abheben. Die scharfe Scheidungslinie wird kaum von der sanften Rundung des eng am Körper liegenden weiblichen Arms, betonter jedoch seitens des Tänzers durch den Ärmel seines Bolero angeschnitten, dessen Spitze aggressiv in die Kopfform der Frau ragt. Im Unterschied zur leiblichen Sinnlichkeit bei van Dyck definieren sich diese Figuren gerade durch die Vermeidung jeglicher ‚peinture‘. Im weitgehenden Fehlen von Binnenzeichnung wirken sie seltsam abwesend – schemenhaft immateriell, wie ausgespart die weiße Frauengestalt, in Bewegung erstarrt, wie zulackiert die schwarze Silhouette des Tänzers. Die Verwendung des industriellen Autolacks Ripolin als Malmaterial war zu Beginn der zwanziger Jahre nicht nur unkonventionell und schockierend, sondern vermochte durchaus auch Assoziationen von potent besetztem Warenglanz zu wecken, wobei Picabia, der begeisterte Liebhaber schneller Luxuswagen, sicher nicht ohne leise Ironie mit geschlechtsspezifischen Klischees spielte. In diesem Sinne sind nicht zuletzt auch die beiden Schriftzüge, „La nuit espagnole“ (Die Spanische Nacht) und „Sangre Andaluza“ (andalusisches Blut) zu lesen, die, der maskulinen Bildhälfte zugeordnet, wie Etiketten das Dargestellte augenzwinkernd kommentieren. Besondere Aufmerksamkeit erregen die einzigen Farbakzente, die in Form konzentrischer Kreise gleich Zielscheiben Geschlecht und Brust der Frau markieren. Als Fokus des Begehrens, ähnlich dem pointiert roten Tuchzipfel bei van Dyck, reduzieren sie die männliche Energie auf sexuell ausgerichtetes Verlangen, dem der weibliche Part wehrlos ausgeliefert erscheint. Ebenso wie Jupiters gedoppelter Adlerblick sein Ziel fixiert, hat der spanische Protagonist, das Auge als hervorstechende weiße Raute betont, die Beute fest im Visier. Jedoch bricht Picabia auch hier mit einem weiteren ironischen Hakenschlag die Eindeutigkeit des dualen Aufbaus, indem er die wahllos über beide Gestalten verteilten einschußartigen Punkte als absurde, das Geschehen möglicherweise kommentierende Bildebene hinzufügt. Dunkel und hell, männlich und weiblich, aktiv und passiv, aus diesen stereotypen Gegensätzen beziehen beide Gemälde wesentlich ihre direkte Wirkung. Der Frau als unschuldig schlafendem, bewegungs- und blicklos in sich gekehrtem Ziel tritt der Mann besitzergreifend handelnd gegenüber. Dem Dunkel-Diabolischen oder Naturhaft-Wilden seiner Person kontrastiert das Sanfte, anmutig Helle der weiblichen Erscheinung. Die schutzlose Nacktheit der Frau und die betont virile Besetzung als Fruchtbarkeitsdämon oder Flamencotänzer bedienen zusätzlich diesen Gemeinplatz. Trotz faktischer Nähe dominiert dabei die bildräumliche Trennung das Verhältnis beider Figurenpaare, läßt kein verschmelzendes Miteinander als Liebespaar entstehen. Beide Künstler führen uns dieses Spiel jedoch bewußt auch als Klischee vor Augen. So wird bereits bei van Dyck dem Sujet durch das begleitende Vorhangmotiv auch ein Moment des Inszenierten und damit Typisierten zuteil; eine distanzierende Brechung, die Picabia mit seiner ins Extrem gesteigerten schablonenhaften Darstellung zu sarkastischer Meisterschaft führt.
St. Diederich