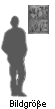Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 14. Woche - 6. April bis 12. April 2015
In den letzten 50 Jahren wurden dieser im ausgehenden 14. Jahrhundert entstandenen Tafel drei unterschiedliche Titel gegeben: Allegorie über Tod und Auferstehung Christi (1948), Tafel mit österlichen Darstellungen (1964), Fünf Christusdarstellungen (1969). Die hier zutage tretende immer stärkere Vereinfachung der Bezeichnung ist ein Zeichen der wachsenden Unsicherheit, mit der die Wissenschaftler der Darstellung begegneten. Je genauer man dieses Gemäldes in seiner Thematik betrachtet, desto stärker zeigt es seine besondere, außergewöhnliche Position innerhalb der mittelalterlichen Malerei.
Für das Verständnis der Tafel ist die vom Maler vorgegebene Aufteilung in zwei thematische Ebenen, die durch ein rotes Band getrennt werden, von Bedeutung. Oben links beginnt die durch diese Teilung provozierte Leserichtung mit der Darstellung des Leichnams Christi im Grab. Darüber angeordnet sieht man die sogenannte „Notgottes“, Gottvater mit seinem toten Sohn, in diesem Fall sogar mit Christus am Kreuz. Dieses Kreuz muss man mit Johannes und Maria am linken Bildrand zusammen sehen. Somit wird auch die Kreuzigung selbst präsent. Diese Kombination von angedeuteten bzw. abgewandelten Themen zeigt an, dass hier verschiedene theologische Aspekte auf „engstem Raum“ komprimiert werden: Der wahre Mensch Jesus (Leichnam im Grab) starb am Kreuz (Gekreuzigter, Maria, Johannes) den Opfertod im Gehorsam gegenüber dem Vater (Not Gottes).
Dass man nun Christus das Grab aufrecht verlassen sieht, ist kein Symbol der Auferstehung: Hier geht der verstorbene Gottessohn - der mittelalterlichen und biblischen Auffassung gemäß wie jeder Mensch - in das „Reich des Todes“, den „Hades“ (vgl. Offenbarung 1, 18). Der Maler schildert diesen Ort personifiziert, so wie er in dem im Mittelalter populären Nikodemus-Evangelium beschrieben wird: als „allesfressendes und unersättliches“ Maul. Absolut folgerichtig zeigt er das Maul dabei doppelt, denn die Gerechten waren nicht am gleichen Ort wie die Ungerechten. Christus kommt nun jedoch als Mächtiger in den Hades. Er wird dort nicht bleiben, sondern die Heiligen des Alten Bundes (zu sehen sind Adam und Eva) sogar mitnehmen. Das Nikodemus-Evangelium schildert dies in einem Gespräch zwischen Hades und dem Satan, unser Maler zeigt dies in dem verzweifelten Teufel oberhalb des Mauls.
Die untere Bildebene zeigt zwei Szenen mit dem Auferstandenen, zwei österliche Szenen: Zunächst, links, Maria Magdalena, welche den Leichnam Jesu sucht und dabei Christus für den Gärtner hält, daneben dann Christus und den ungläubigen Thomas. Den Endpunkt bildet wieder eine malerisch komprimierte theologische Betrachtung: Wir sehen den Schmerzensmann, den mit Wunden übersäten, aber lebenden Christus. Symbole seines Leidens umgeben ihn, bis hin zu den sorgsam abgezählten 30 Silberlingen. Während das erste Betrachtungsbild die Heilstat Christi aus der Sicht Gottvaters vorstellte („Die Darbringung des Opfers“), ist nun Christus („der Geopferte“) Betrachtungsgegenstand. Fasst man die gesamte Thematik zusammen, so möchte man dem Werk einen neuen Titel geben: Theologische Betrachtungen zu Tod und Auferstehung Christi.
Die kunsthistorische Einordnung dieses Werks ist ähnlich unsicher wie die thematische. Zunächst der Kölner, dann der Niederrheinischen Malerei zugeschrieben, wird es heute als westdeutsch bezeichnet. Gegen die Datierung in das ausgehende 14. Jahrhundert erhob nur Änne Liebreich (1928) Einspruch, da die dargestellte Kopfbedeckung der Soldaten erst nach 1410 in Mode gekommen sei.
T. Nagel