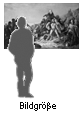Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 31. Woche - 3. bis 9. August 2009
Teil 2 von 2: Personen und Entstehung Im letzten Bild der Woche stellten wir Ihnen die neue Deutung dieses Gemäldes vor (Gesamtaufnahme s. erstes Bild rechts). Demnach hielten die beiden flämischen Künstler Gustave Buschmann (1818-1852) und Edouard Hamman (1819-1888) auf ihrem für dieses Thema erstaunlich kleinen Gemälde nicht die Schlacht bei Worringen von 1288 fest, sondern den Moment des Sieges in der Schlacht an der Ulrepforte im Jahre 1268. Hier besiegten das Geschlecht der Overstolz unter der Führung des Matthias Overstolz die in die Stadt eindringenden Kämpfer des Geschlechtes der Weisen. Hamann war Schüler von Nicaise de Keyser (1813-1887), dessen Bild "Nach der Schlacht von Worringen" zwei Jahre früher entstanden war (eine kleinere Variante von 1840 seit 1884 im Besitz des Wallraf-Richartz-Museums, s. zweites Bild rechts). Auch Buschmann hatte in Antwerpen studiert. Ihr Gemälde, bei dem die Arbeitsteilung nicht erkennbar ist, verrät mit seinem klassischen Bildaufbau denn auch die akademische Herkunft, ebenso wie das Kolorit auf Flandern als Ursprungsland deutet: Links steht eine Gruppe Männer, von denen zwei einen weiteren zu stützen scheinen. Der rechts stehende hält ein Schwert nach unten in Richtung eines gestürzten alten Mannes in einfacher Kleidung, der die Hand bittend hoch hält. Über ihm ist ein Haus an der Stadtmauer zu erkennen. Das einfache Haus an der Stadtmauer soll wohl das des Havenit oder Habenichts sein, der liegende Mann könnte dann der verräterische Schuster sein, der um Gnade bittet. Bei dem gestützten Mann links handelt es sich entweder um Walram von Limburg oder Dietrich von Falkenburg, den Bruder des Erzbischofs Engelbert - beide haben ein Wappen mit einem roten, zweischwänzigen Löwen. Der Mann rechts von ihm trägt das Grin-Wappen. Richwin Grin war ein Mitglied der siegreichen Overstolzen-Partei, ein Verwandter des legendären Bügermeisters Hermann. Der Greis auf dem Schild ist anhand seines Wappens als ein Overstolz identifiziert. Auch sein weißes Haar weist ihn als Anführer aus, gleichzeitig ist er vom Kampf gezeichnet. Es handelt sich um den zu Tode verwundeten Matthias Overstolz. Den vorderen Träger ziert ein städtisches Wappen, aber auch einfache Handwerker sind unter den Trägern, um den Rückhalt durch die Stadtgemeinde zu symbolisieren. Auch der junge Mann rechts trägt das Overstolz-Wappen, es ist wohl Gottschalck, unter ihm auf dem Boden Costyn von der Aducht, einer der Verlierer. Besonders angesichts der beiden Antwerpener Maler stellt sich die Frage nach dem Auftraggeber. Nach Gründung des belgischen Staates entstanden zahlreiche Historienbilder zur belgischen Geschichte. Die berührten gelegentlich auch die Kölner Stadthistorie wie z. B. die Schlacht bei Worringen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass ein belgischer Auftraggeber Interesse an der Schlacht an der Ulrepforte hatte, die nur von lokaler Bedeutung war. Gleichzeitig gab es aber enge gewachsene und aktuelle wirtschaftliche Beziehungen zu Antwerpen mit seinem Hafen, so war z. B. gerade der Eiserne Rhein (s. http://www.der-eiserne-rhein.de) im Entstehen. Bei dem Gemälde handelt es daher ziemlich sicher um eine Kölner Auftragsarbeit an die beiden jungen Antwerpener Maler, aber über den Auftraggeber oder die Umstände ist nichts weiter bekannt. Am oberen Rand des Originalrahmens befindet sich ein hochformatiges Oval, dort könnte ein Wappen vorgesehen gewesen sein. Auch weiß man nicht, wer die Künstler historisch beriet. Als Quellen dienten wohl die Reimchronik Gottfried von Hagens und die Koelhoff’sche Chronik. Als Vorlage wählten die beiden aber nicht das damals noch sehr restaurierungsbedürftige Relief an der Ulrepforte mit den Reitern, den Engeln und Heiligen, sondern orientierten sich vielmehr an de Keysers Worringen-Bild. Die "Schlacht an der Ulrepforte" wirkt fast wie ein Spiegelbild mit seiner umgekehrter Diagonale, den Herzog auf dem Pferd ersetzt der Overstolz auf dem Schild. Während sich de Keysers Farbigkeit aber stark an Rubens orientiert, stehen die beiden jungen Schüler eher in altniederländischer Tradition.
R. Wagner