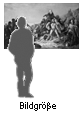Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 30. Woche - 27. Juli bis 2. August 2009
Teil 1 von 2: Das Thema der Darstellung Diese Schlachtenszene galt bislang als eine Darstellung der Gefangennahme des Kölner Erzbischofs Siegfried von Westerburg nach der Schlacht bei Worringen 1288. Merkwürdigerweise scheint niemanden verwundert zu haben, dass der Besiegte von den Kölnern auf einen Schild gehoben wurde. Gilt doch seit altersher die Geste des auf den Schild Hebens als eine ehrenvolle Geste, die man nur Anführern erweist. Darüber hinaus kann man an der Mauer im Hintergrund deutlich Gewölbe und Laufgang erkennen, was nur im Innern einer Stadt zu sehen ist, nach außen sind Stadtmauern glatt. Also stellte sich die Frage, um welches Ereignis der Kölner Stadtgeschichte es sich handelt, denn eines der Wappen ist deutlich als Kölner Stadtwappen zu erkennen. Eine genauere Inaugenscheinnahme der dargestellten Personen zeigte, dass der Mann auf dem Schild das Wappen des Kölner Geschlechts der Overstolzen trägt, wohingegen das Wappen mit dem roten, zweischwänzigen Löwen auf der Brust des Gefangenen links ihn als Mitglied der Limburger oder Falkenburger ausweist. Damit lag es nahe, die Szene als Schlacht an der Ulrepforte zu identifizieren. Im Jahr 1268 befehdeten sich in Köln die Geschlechter der Weisen und der Overstolzen. Erzbischof Engelbert von Falkenburg unterstützte dabei die Weisen. In den folgenden Kämpfen behielten die Overstolzen die Oberhand, woraufhin die Weisen die Stadt verließen. Die Stadtlegende berichtet nun, dass ein armer Schuhflicker mit dem vielsagenden Namen "Habenichts", der seine Wohnung unter einem der Bögen an der Ulrepforte hatte, bestochen worden sei, ein Loch unter der Mauer zu graben, damit die Feinden unbemerkt eindringen könnten. Da der Kölner Erzbischof zwischenzeitlich in Gefangenschaft geraten war, suchten die Weisen Unterstützung beim Herzog von Limburg und dem Bruder des Erzbischofs, Dietrich von Falkenburg. Der Überfall auf die Stadt war für die "Nacht der hl. Mohren", also den 14. auf den 15. Oktober 1268, verabredet. Der Limburger kroch mit seinen Leuten durch das Loch und öffnete von innen die Ulrepforte, um den restlichen Haufe einzulassen. Dort wartete man auf die aus der Stadt zugesagte Unterstützung, um die Overstolzen in ihren Betten zu ermorden, aber ein wachsamer Bürger bemerkte die Eindringlinge und alarmierte die potentiellen Opfer. Diese bewaffneten sich und zogen unter der Führung des Matthias Overstolz den Feinden entgegen. Er gehörte zu den ersten Opfern und wurde zu Tode verwundet. Der Sterbende feuerte die Kölner an: "Gehet, helfet den Lebenden den Sieg erringen und kümmert euch heute nicht um die Toten ... Fröhlich will ich sterben, wenn ich weiß, dass der Sieg unser." Daraufhin warfen sich auch die einfachen Bürger, die Handwerker, Gesellen, Kaufleute, in die Schlacht und bezwangen die Aggressoren. Unter den Gefangenen waren auch die Anführer: der Herzog von Limburg und Dietrich von Falkenburg. Diesen Moment des Sieges haben die beiden flämischen Künstler Gustave Buschmann (1818-1852) und Edouard Hamman (1819-1888) festgehalten. Wer nun welche Person auf dem Bilde ist, welche Vorbilder das Werk hatte und wie es zu diesem Auftrag kam, erfahren Sie im nächsten Bild der Woche.
R. Wagner