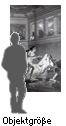Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 36. Woche - 7. September bis 13. September 2015
Louis Lafitte (Entw.), Dufour et Cie (Ausf.): Das Orakel des Apoll. 1. Szene aus dem Tapetenzyklus „Amor und Psyche“, Paris, um 1816. Handdruck mit Leimfarbe auf Hadernpapier, 187 x 108 cm (Foto: © KSM)
Ein schöner Jüngling liegt ausgestreckt auf einem reich verzierten Bettmöbel, friedlich schlafend in tiefster Vollmondnacht. Von links nähert sich eine anmutige Frauengestalt mit einer Lampe. Sie scheint wie gebannt vom Liebreiz des Knaben. Auf den ersten Blick ein harmonisches Bild – doch bei näherem Hinsehen bleiben Fragen offen: Was hat es mit dem Dolch am Boden auf sich? Wieso hat der Jüngling Flügel und wer dringt da des Nachts in sein Schlafgemach ein?
Das Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts kannte die Antworten auf diese Fragen: Dargestellt ist eine Schlüsselszene der mythologischen Geschichte von Amor und Psyche, überliefert in einem Roman des römischen Autors Apuleius aus dem 2. Jahrhundert nach Christus: Die Königstochter Psyche möchte herausfinden, welcher Unbekannte sie Nacht für Nacht beglückt – und trifft nicht auf das erwartete Ungeheuer, sondern auf den schönen Liebesgott.
Die Darstellung stammt aus dem Jahr 1816. Damals nahm die Begeisterung für den antiken Mythos im wahrsten Sinne des Wortes ungewöhnliche Ausmaße an: Bei dem Bild handelt es sich um eine gut zwei mal einen Meter große Papiertapete aus einem zwölfteiligen Zyklus mit der Geschichte von Amor und Psyche. Der Tapetensatz wurde ab 1816 von der Pariser Manufaktur Dufour et Cie hergestellt – als Druck auf Papier, ausschließlich mit Grau- und Weißtönen.
Im Kölnischen Stadtmuseum haben sich acht der ehemals zwölf Szenen aus einer sehr frühen Auflage erhalten. Sie schmückten im 19. Jahrhundert ein Kölner Bürgerhaus am Maria-Ablaß-Platz 16 (heute Börsenplatz 1). Dort hatte sich nach der 1802 erfolgten Auflösung des Stiftes von St. Ursula der Kölnisch-Wasser-Produzent und Kunstsammler Johann Baptist Ciolina-Zanoli (1759–1837) mit seiner Familie niedergelassen.
Mit dem Tapetensatz „Amor und Psyche“ ließ Ciolina-Zanoli wohl den Salon des Hauses ausstatten. Allerdings hätte sich der Zyklus auch für das Schlafzimmer geeignet – erzählt die Geschichte doch von Liebe, Lust und Leidenschaft im wahrsten Sinne des Wortes:
Die sterbliche Königstochter Psyche erregt mit ihrer Schönheit den Neid der Göttin Venus und soll daher mit einem Ungeheuer vermählt werden. Venus’ Sohn Amor verliebt sich jedoch in Psyche, rettet sie in seinen Palast und nimmt sie dort zur Frau. Allerdings dürfen die Beiden nur die Nächte miteinander genießen, am Tage bekommt Psyche ihren Gemahl nicht zu Gesicht und bleibt über seine Identität im Unklaren. Psyches neidische Schwestern wecken ihr Misstrauen gegenüber dem geheimnisvollen Ehemann: Sollte es sich doch um das prophezeite Ungeheuer handeln? Eines Nachts beschließt Psyche, es herauszufinden und das Monster zu töten.
Hier setzt die gezeigte fünfte Szene ein: Psyche hat soeben Amors Schlafgemach betreten und hält inne, fasziniert von seiner Schönheit. An Psyches ursprüngliche Tötungsabsicht erinnert noch der Dolch am Boden. Die Tauben und die Rüstungsteile im Vordergrund verweisen auf Amors Eltern: die Liebesgöttin Venus und den Kriegsgott Mars.
Noch schläft Amor, doch die brennende Lampe kommt seinem Gesicht bereits gefährlich nahe. Gleich wird ein heißer Öltropfen auf die Schulter des Schlafenden fallen. Er erwacht und fliegt davon, enttäuscht über Psyches Misstrauen. Sie muss anschließend zahlreiche Strafaufgaben bewältigen, bis ein Happy End die Liebenden im Olymp wieder vereint.
Mit den Bildtapeten stellte Johann Baptist Ciolina-Zanoli seinen hohen Bildungsstand und seine zeitgemäße Ausrichtung an französischem „Design“ zur Schau. Auch nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft orientierte sich die kulturelle Entwicklung in Köln weiter an Frankreich. Die Tapetenserie „Amor und Psyche“ stand ganz im Zeichen des Empire-Stils: Diese Spätphase des Klassizismus hatte sich unter Napoleon als Staatsstil entwickelt und dann in ganz Europa durchgesetzt. Das Empire hielt am Vorbild der Antike fest, lockerte die klassizistische Strenge jedoch durch verspieltere Formen und eine Freude am Detail auf.
Die Entwürfe für die Szenenfolge „Amor und Psyche“ lieferten französische Künstler. Nach ihren Vorlagen wurde für jede einzelne Bildpartie und -farbe ein eigenes Druckmodel gefertigt – insgesamt über 1400 Stück. Der Bildaufbau erfolgte von der dunkelsten bis zur hellsten Farbe. Mit ihren feinen Abstufungen und Details machten die Papiertapeten gemalten Wandbildern Konkurrenz, waren aber vergleichsweise günstig. Als Serienprodukt auf höchstem künstlerischen Niveau erfüllten sie die Ansprüche des aufstrebenden Bürgertums an eine dekorative und repräsentative Raumausstattung.
Das Haus am Maria-Ablaß-Platz wurde 1898 abgerissen. Danach verlieren sich die Spuren der Tapeten zunächst Es gibt Hinweise auf eine ursprüngliche Verwahrung im Kunstgewerbemuseum (heute: Museum für Angewandte Kunst Köln). In den 1930er-Jahren waren die Tapeten im Haus der Rheinischen Heimat ausgestellt , einer Vorgängerinstitution des heutigen Kölnischen Stadtmuseums.
J. Kirchhoff