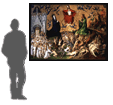Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 47. Woche - 18. bis 25. November 2002
Eines der bekanntesten Werke des Wallraf-Richartz-Museums - Fondation Corboud in Köln ist die Weltgerichtsdarstellung des spätmittelalterlichen Malers Stefan Lochner. In einer kleinen Serie sollen in den nächsten Wochen verschiedene Aspekte dieses Werkes vorgestellt werden und damit der Anfang für eine vergleichbare Präsentation weiterer Werke der Kölner Museen aus unterschiedlichen Epochen und Gattungen gemacht werden. Es ist für die Kölner Kunst des 15. Jahrhunderts singulär, daß man den Namen eines Künstlers mit einem Gemälde in Zusammenhang bringen kann. Malerei war zu diesem Zeitpunkt im Verständnis der Kölner Maler noch ausschließlich Handwerk und nicht Kunst. Kein Handwerker kam jedoch auf die Idee, zu signieren. Wenn wir heute von Stefan Lochners Weltgericht sprechen, so können wir diese Aussage also nicht auf eine erhaltene Signatur stützen . Es existiert keine Urkunde, etwa ein Kaufvertrag oder eine Rechnung, aus der uns die Autorenschaft überliefert wäre. Grundlage der Zuschreibung an Lochner ist zunächst nur ein stilistischer Vergleich: In der Forschung ist allgemein anerkannt, daß die Darstellung des Weltgerichts in einem stilistischen Zusammenhang mit dem sogenannten Altar der Stadtpatrone (s. kleines Bild) steht, der Stefan Lochner zugeschrieben wird. Auch diese Zuschreibung geschah jedoch nicht auf der Basis von Urkunden. Der Name Stefan Lochner läßt sich nur aus Bemerkungen erschließen, die Albrecht Dürer bei einem Kölnaufenthalt im Oktober 1520 über Meister Stefan in sein Tagebuch der Reise in die Niederlande notierte. Seit 1823 nimmt man mit Johann Friedrich Boehmer an, daß Dürer mit seinem Tagebucheintrag diesen Altar der Stadtpatrone meinte. Zudem gab es zum Entstehungszeitpunkt dieses Altares in Köln nur einen Meister Stefan, nämlich Stefan Lochner. Es ist also nicht ganz so eindeutig, daß "Lochners Weltgericht" wirklich von Stefan Lochner stammt. Andererseits sind bisher auch keine Details bekannt, welche den um die Angaben Dürers gerankten biographischen Angaben zum Leben und Schaffen Stefan Lochners widersprechen würden. Lassen wir die Frage nach der Autorenschaft bis zum nächsten Bild der Woche einmal dahingestellt und wenden uns der Darstellung als solcher zu. Das Bild zeigt im Zentrum Christus als den Weltenrichter. Er sitzt auf einem doppelten Regenbogen und hat die Hände zum Segen und zur Verdammnis ausgestreckt. Seine Rechte segnet die Gerechten: "Kommt ihr Gesegneten meines Vaters! Nehmt in Besitz das Reich das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt." (Matth. 25,34). Die wegweisende Linke gilt den Verdammten: "Weicht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel bereitet ist und seinen Engeln." (Matth. 25,41). Diese Gesten und Worte gelten der Vielzahl von Menschen, die kleiner dargestellt, den unteren Teil des Bildes bevölkern. Hier stehen die Toten aus ihren Gräbern auf, hier ziehen die Gerechten links in den Himmel ein, hier werden die Verdammten rechts in die Hölle gezogen. Neben Christus knien Maria und Johannes der Täufer. Sie sind nicht nur wegen ihrer an der Christusdarstellung orientierten Größe "Begleitpersonen" der himmlischen Herrlichkeit. Sie sind vielmehr auch die mächtigsten Fürbitter, welche die Menschen bei Christus haben. Maria wurde am Kreuz der gesamten Menschheit als Mutter anvertraut (Joh. 19,26f.) und von Johannes dem Täufer sagte Christus, daß er der größte unter den "von einer Frau geborenen" sei (Matth. 11,11). In den nächsten Folgen dieser Serie erfahren Sie etwas zu Stil und Komposition, zur Geschichte und weiteres zur Autorenschaft dieses Gemäldes und erhalten ferner ikonographische und historische Informationen zu den zahlreichen Details der Darstellungen.
T. Nagel