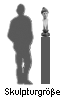Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 35. Woche - 1. September bis 7. September 2014
Es ist eine junge Frau, die den Betrachter versonnen anblickt, dabei wird ihr Mund von einem ganz leichten Lächeln umspielt. Die lockigen, dunklen Haare sind auf dem Hinterkopf zu einem Knoten zusammengefasst. Der Kopf geht über den Hals in den schmalen tiefen Brustausschnitt gleichsam als Stütze über. Ein holzfarbener runder Fuß schließt die Figur ab.
Handelt es sich hier in erster Linie um die Darstellung einer jungen Frau oder ist mehr beabsichtigt? Der Künstler, Max Klinger (1857-1920), hat ihr den Titel „Neue Salomé“ gegeben. "Neu", in Abgrenzung zur überlieferten Salomé, die im Auftrag ihrer Mutter für einen Schleiertanz vor ihrem Stiefvater Herodes Antipas den Kopf des Johannes gefordert haben soll, ist eine Frau dargestellt, die durch Einsatz ihrer körperlichen Reize die Männer gleichzeitig anzieht und ihnen Furcht einflößt, eine „Femme fatale“. Diese neue, schicksalhafte Salomé, ein Produkt männlicher Wunschbilder und Ängste, ist zum Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ein weit verbreitetes Sujet in Literatur, Musik und Kunst, wie bei Oscar Wilde 1891, Richard Strauss 1905 und eben auch bei Klinger.
Die aus Gips gefertigte Skulptur der Salomé ist farblich gefasst, also bunt bemalt. Die farbige Behandlung von Skulpturen hat eine bis in die Antike zurückreichenden, archäologisch belegte Tradition, kam aber zwischenzeitlich aus der Mode und so waren später steinfarbige Skulpturen das Ideal. Klinger setzte hier die Farbigkeit gezielt ein, um die Wirkung seiner Werke zu steigern.
Der Werkzusammenhang und die Datierung der Kölner Salomé sind nicht eindeutig zu bestimmen. Ob es eine der Vorstudien zu der Marmorskulptur der „Neuen Salomé“ im Museum der Bildenden Künste in Leipzig ist oder später als Modell für einen selbstständigen Bronzeguss angefertigt wurde, ist nicht eindeutig zu klären.
Die Salomé aus Leipzig ist eine Halbfigur, die aus vier verschiedenfarbigen Marmorsorten gearbeitet ist. Abweichend von der überlieferten Darstellung wird sie begleitet von zwei Köpfen, einen noch im Tod schmachtenden Jüngling und einen verlebten Alten. Klinger sagte selbst, er habe seiner Salomé zwei Johannesse beigegeben.
Der Kopf mit dem Brustausschnitt der Leipziger Salomé wurde - wie auch die Hände - aus pentelischem Marmor gefertigt und stimmt weitgehend mit dem Kölner Gips überein. Das Gewand und die beiden Köpfe wurden jeweils aus andersfarbigen Marmorsorten gemeißelt und anschließend zum Teil noch eingefärbt. Eine besonders lebendige Wirkung wurde durch die Verwendung von geschliffenem Bernstein für die Augen der Salomé und des Jünglings erzielt.
Unsere Kölner Gipsskulptur wirkt durch die Konzentration auf das Gesicht und das schmale Dekolleté noch direkter, verführerischer als die vollständige Halbfigur, erhält aber dazu noch durch die rote Bemalung der Seiten etwas morbides, so als sei die Büste aus dem lebendigen Fleisch geschnitten.
H. Bachem