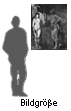Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 3. Woche - 15. bis 21. Januar 2007
Was hat Hans von Marées in diesem um 1868 gemalten Bild darstellen wollen? Diese Frage ist schwieriger zu beantworten, als es zunächst scheint. Ein Mann und eine Frau stehen in einigem Abstand nebeneinander. Sie wenden sich einander zu: Die Frau blickt den Mann an und er hat seinen Körper leicht in ihre Richtung gedreht. Sein Blick ruht auf dem Betrachter. Zwischen ihnen im Hintergrund steht gut sichtbar ein Baum. Da beide, bis auf das rote Tuch, das der Mann sich um die Hüften gelegt hat, nackt sind, könnte man vermuten, daß es sich hier um eine Darstellung des Sündenfalls handelt. Unsere beiden Figuren würden dann Adam und Eva, verkörpern. Um diese These zu prüfen sehen Sie rechts als Vergleichsbild eine Darstellung des Sündenfalls von Palma Vecchio, die um 1512 entstanden ist. Es ist also ein Gemälde der italienischen Renaissance, welche sich Marées zum Vorbild nahm. Adam und Eva, beide nackt und nur ihre Scham mit einem Feigenblatt bedeckend, sind ebenfalls frontal ins Bild gesetzt. Doch haben sie ihre Köpfe einander zugewandt und schauen sich in die Augen . Die leichte Körperdrehung Evas zu Adam hin, ist in ihrer Handlung begründet. Sie reicht Adam den Apfel der Erkenntnis. Aus der Baumkrone schaut der Kopf der Schlange hervor, die Eva angestiftet hat, den Apfel zu versuchen. Handlung und Requisiten machen für den Betrachter die beiden Dargestellten eindeutig als Adam und Eva identifizierbar. Unser Gemälde von Marées läßt nicht diese Eindeutigkeit der Darstellung erkennen: Die junge Frau hält zwar etwas in ihrer rechten Hand, aber es ist nicht zu erkennen, was es ist. Ein Apfel ist es jedenfalls nicht. Auch nach der Schlange sucht man vergebens und so kann man nicht mit Sicherheit sagen, daß Hans von Marées hier den Sündenfall darstellen wollte. Vielleicht kann uns der überlieferte Titel des Bildes weiterhelfen. Nicht etwa Marées, sondern sein Schüler, Hermann Prell, hat dem Bild den Titel Ekloge gegeben. Als Eklogen bezeichnet man die Hirtengedichte der Antike. Vergil, zum Beispiel, wählte als Hintergrund dieser Gedichte Arkadien, eine idyllische Landschaft und Heimat des die Hirtenflöte spielenden Gottes Pan. Sicher läßt sich die Waldlandschaft im Hintergrund unseres Bildes als idyllisch bezeichnen, so wie sie in der Hirtendichtung Vergils beschrieben wird. Doch keine Musikinstrumente und auch keine Ziegen, von denen bei Vergil die Rede ist, lassen sich erblicken. Auch diese Deutung der Darstellung bleibt also unbefriedigend - es sei denn, man betrachtet den Titel nicht als Hinweis auf ein konkretes Bildthema, sondern als Benennung einer Stimmung: Ekloge, idyllische Landschaft, Arkadien. Offensichtlich kam es Marées nicht auf eine Erzählung an, die der Betrachter in seinem Gemälde unmittelbar ablesen sollte. Vielmehr werden die Figuren, die Komposition und das Hell-Dunkel der Farben zum Ausdruck von Harmonie. Konrad Fiedler, Freund und Mäzen des Malers, der als Kunsttheoretiker das Werk Hans von Marées begleitete, formulierte dessen Anliegen etwa so: “Ein Künstler ist derjenige, dem die Natur von vornherein ein Ideal in die Seele gesenkt hat. Dieses Ideal ist es, welches in ihm die Stelle der Wahrheit vertritt, und an das er unbedingt glaubt und in welchem er das Wesen der Dinge erkennt. Seine Lebensaufgabe besteht nun darin, zur Anschauung der anderen und sich selbst dieses Ideal zum reinsten Ausdruck zu bringen, also das zu malen, was das von ihm wahrgenommene Wesen der Dinge ist.“
E. Klother