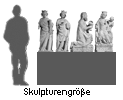Wir überarbeiten zur Zeit unser Online-Angebot. Daher pausiert das "Bild der Woche" aktuell.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Bild der 43. Woche - 27. Oktober bis 2. November 2014
Anbetung der Heiligen Drei Könige vom Dreikönigenpförtchen,
Köln, 1. Drittel 14. Jahrhundert, Kalksandstein, geringe Reste einer älteren Fassung und einer Fassung des 19. Jahrhunderts, H. 88 cm (Maria), 86 cm (Caspar), 89,5 cm (Melchior), 88 cm (Balthasar), Köln, Museum Schnütgen, Leihgabe des Stadtkonservators seit 1958, ohne Inv.
Das Dreikönigenpförtchen bei St. Maria im Kapitol ist vielleicht der bekannteste Tordurchgang Kölns. Laut einer „alten Überlieferung“ soll das Törchen an jener Stelle errichtet worden sein, an der der Erzkanzler und Kölner Erzbischof Rainald von Dassel die Gebeine der Heiligen Drei Könige aus Mailand in die Stadt Köln hineingeführt habe. Wie so manche vermeintlich alte Überlieferungen ist auch diese Legende eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, wohl in Zusammenhang mit dem drohenden Abriss des Tores in die Welt gesetzt. Sie schenkte dem Dreikönigenpförtchen jedoch große Aufmerksamkeit, so dass es erhalten wurde.
Die Kalksteinfiguren, die man heute in dem Maßwerkgehäuse über dem Torbogen bestaunen kann, sind Kopien. Die gotischen Originale, deren ursprüngliche Farbfassung durch Witterungseinflüsse fast gänzlich verloren gingen, sind nun im Museum Schnütgen zu finden.
Die Art ihrer Gestik, der leicht nach unten geneigte Kopf der Jungfrau Maria und des Jesuskindes sowie die vergleichsweise geringe Bearbeitung der Kopfplatten, geben zu erkennen, dass der Bildhauer bei ihrer Anfertigung die Perspektive des Betrachters mit einberechnete. Dieser schaute vom sogenannten „Lichhof“, dem östlich am Chor von St. Maria im Kapitol gelegenen ehemaligen Friedhof des Stiftes, zu der Szene empor. Ihrerseits wachten die Figuren über diejenigen, die dort begraben lagen. Als Schutzheilige der Reisenden sollten sie Fürbitte für alle Pilger und reisenden Kaufleute leisten, die im nahegelegenen Fremdenhospital verstorben waren und dort beigesetzt wurden.
Durch ihren Platz im Museum ist es nun möglich, sich die qualitätvolle Figurengruppe einmal ganz aus der Nähe anzusehen. Schaut man genau hin, kann man die Reste der Farbfassung und sogar die feinen, reliefartigen Erhebungen erkennen, die auf die Verzierung der Königsgewänder mit reicher Ornamentik hinweisen. Wegen ihrer besonderen Figurenproportionen, der weichen Modellierung und den sanften, gütig wirkenden Gesichtszügen werden sie stilistisch mit einer Gruppe lothringischer Steinskulpturen in Verbindung gebracht.
J. Beutner